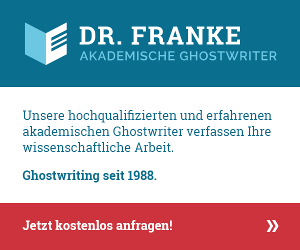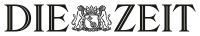Okidoki, welchen Vertrag hat also der Liegenlasser mit dem Verkäufer geschlossen?
Wenn man die Anspruchsgrundlagen durchgaloppiert findet man ..... nix.
Also könnte es sich um eine Schenkung handeln.
Die Schenkung ist ein einseitig verpflichtender Schuldvertrag, der auf eine unentgeltliche Zuwendung gerichtet ist (vgl. § 516 Abs. 1 BGB). Die Schenkung ist außerhalb familiärer Umfelder eher selten. Größere Schenkungen außerhalb des Familienkreises unterliegen schon bei geringeren Beträgen der Schenkungssteuer, während familienangehörige erhebliche Freibeträge wie bei der Erbschaftssteuer haben.
a) Vertragsschluss, keine Gefälligkeit
Der Vertragsschluss unterscheidet die Schenkung von einem reinen Gefälligkeitsverhältnis, bei dem gerade keine rechtliche Bindung eingegangen werden soll. Aus dem Erfordernis des Vertragsschlusses folgt, dass sich niemand ohne oder gar gegen seinen Willen etwas schenken zu lassen braucht. Bis zur Annahme des Schenkungsangebots besteht ein Schwebezustand, den der Zuwendende, mithin der Schenker, durch Fristsetzung beenden kann; Schweigen innerhalb der Frist gilt hier als Annahme (§ 516 Abs. 2 BGB).
b) Verpflichtungsgeschäft
Der Schenkungsvertrag ist als schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft von der Erfüllung (Verfügungsgeschäft, z. B. Übereignung der geschenkten Sache, Abtretung der geschenkten Forderung) zu unterscheiden.
[SIZE=-1]Umstritten ist die Rechtsnatur der vom Gesetz als Normalfall behandelten sog.
Handschenkung (vgl. §§ 516, 517 BGB). Dies ist die sofort vollzogene bzw. erfüllte Schenkung, die formlos (§ 518 BGB unbeachtlich) gültig ist. Das gilt insbesondere für fast alle Gelegenheitsgeschenke (zu Weihnachten usw.) Die Handschenkung besteht lediglich aus dem Einigsein über die Unentgeltlichkeit einer Zuwendung.
- [SIZE=-1]Nach herrschender Meinung ist sie kein Verpflichtungsvertrag, sondern nur Abrede über den Rechtsgrund der Zuwendung (causa donandi), so dass sie nicht erfüllt werden kann, sondern nur ein Herausgabeverlangen nach §§ 812 ff BGB ausschließt.
- [SIZE=-1]Wegen der grundsätzlichen Geltung der Trennung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft wird demgegenüber vereinzelt in der Handgeschenkung ein Verpflichtungsgeschäft gesehen, das nur deswegen äußerlich nicht erkennbar wird, weil es gleichzeitig mit seiner Begründung sofort erfüllt wird.
[SIZE=-1]Wortlaut und Entstehungsgeschichte sprechen für die herrschende Meinung. Jedoch ist die dogmatische Einordnung ohne praktische Bedeutung.
[SIZE=-1]--> [vgl. dazu MünchKomm/Kollhosser, § 516 Rn. 9 m. w. N.]
2. Zuwendung von Vermögenswerten
Gegenstand des Schenkungsvertrages muss eine
Zuwendung von Vermögenswerten sein.
Zuwendung aus dem Vermögen ist Hingabe eines Vermögensbestandteils von einer Person (= Schenker) zugunsten einer anderen (=Beschenkter). Die Zuwendung erfordert mithin eine Vermögensminderung einerseits und eine Vermögensvermehrung andererseits.
z.B. Vermögensminderung
Die (dauerhafte) Vermögensminderung geschieht meist durch Rechtsgeschäft, insbesondere Übertragung oder Belastung von Sachen und Rechten. Der Schenker gibt aber auch dann etwas aus seinem Vermögen her, wenn er dem Vertragspartner etwa eine Schuld erlässt
(OLG Stuttgart NJW 87, 782) oder ihn von einer Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten befreit.
Eine Vermögensminderung auf Seiten des Schenkers setzt nicht voraus, dass der Schenkungsgegenstand selbst vorher zum Vermögen des Schenkers gehörte (keine Stoffgleichheit); es reicht vielmehr aus, dass der Beschenkte den Vermögenswert aus dem Vermögen eines Dritten auf Veranlassung des Schenkers erhält.
Form
Beim Schenkungsvertrag bedarf die Willenserklärung des Schenkers, nicht auch die Annahme des Versprechens, der notariellen Beurkundung (§ 518 Abs. 1 BGB). Grund: Schutz des Schenkers vor leichtfertig erteilten Schenkungsversprechen.
Dieses Schutzes bedarf es dann nicht, wenn die Schenkung - wie sooft im täglichen Leben - mit dem Abschluss des Vertrages gleichsam vollzogen wird. Deshalb ist diese sog.
Handschenkung formfrei gültig.
Okay so?