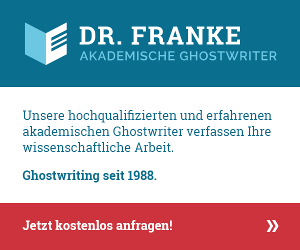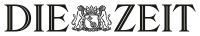kann mir jemand die Übung 3 verständlich machen? Nach mehrmaligem Durchlesen verstehe ich sowohl Thema und Lösung nicht wirklich (außer Punkt a = pareto-effiziente Menge, das mit der Samuelson-Bedingung zu lösen ist).
Konkret: Wie errechnet man sich die Reaktionsfunktion (b), wie kommt man auf die Punkte A-D im Zwei-Konsumenten-Fall (c), wie ist eine negative Steigung von -1 erklärbar (d), woraus schließt man, dass sich die Reaktionsfunktionen durch (px * Alpha i / 2 pz) hoch 2 unterscheiden (d) ? Auch Punkt e verstehe ich nicht.
Bin sehr dankbar, wenn mir jemand hier etwas einfachere Erklärungen als das Skript liefern kann, nehme auch Abstriche in puncto Genauigkeit in Kauf.
Was glaubt ihr, wie wahrscheinlich kommt so ein Beispiel zur Prüfung am Mittwoch?
Konkret: Wie errechnet man sich die Reaktionsfunktion (b), wie kommt man auf die Punkte A-D im Zwei-Konsumenten-Fall (c), wie ist eine negative Steigung von -1 erklärbar (d), woraus schließt man, dass sich die Reaktionsfunktionen durch (px * Alpha i / 2 pz) hoch 2 unterscheiden (d) ? Auch Punkt e verstehe ich nicht.
Bin sehr dankbar, wenn mir jemand hier etwas einfachere Erklärungen als das Skript liefern kann, nehme auch Abstriche in puncto Genauigkeit in Kauf.
Was glaubt ihr, wie wahrscheinlich kommt so ein Beispiel zur Prüfung am Mittwoch?