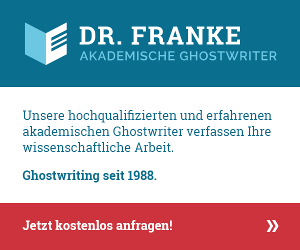
Allokationstheorie - gibt es Schnittstellen zur Realität?
Da ich ein dickes Fell habe, Frage ich Folgendes trotzdem mal - obwohl ich weiß, dass man entweder solche Fragen nicht stellen darf oder gleich als Nixblicker abgelatscht wird... 😀 :
Gibt es eine Schnittstelle zwischen dem im Kurs Allokationstheorie Gelernten und dem in der Realität dieses Erdballs Wahrgenommenen 😱 ?
Bisher konnte ich alles aus der VWL - zumindest grob - mit Inhaltes des Wirtschaftsteiles der Zeitungen in Verbindung bringen: reale und monetäre Außenwirtschaft, Stabi-politik, Umweltökonomie, Industrieökonomik, ja sogar ÖTP...
Aber Allo?
Das two-by-two-by-two Modell kann ich auf eine Robinson-Wirtschaft anwenden. Klar, ist ein Modell, nicht Realität - ok!
Ich sehe aber keine Erkenntnisse darüber, wie man irgendwelche Ergebnisse aus diesem Modell auf eine Wirtschaft mit 100 Sektoren und 100 Millionen Konsumenten / Produzenten umlegen kann/soll.
Berechnen wir ein Produktionsoptimum und dann ein Konsumoptimum und vergleichen wir nachher, obs übereinstimmt - schön und mathematisch auch nicht sooo anspruchsvoll (gut, die Klausur wird mich da eines Besseren belehren....) - aber was bringt das?
Hat jemand eine Idee?
Da ich ein dickes Fell habe, Frage ich Folgendes trotzdem mal - obwohl ich weiß, dass man entweder solche Fragen nicht stellen darf oder gleich als Nixblicker abgelatscht wird... 😀 :
Gibt es eine Schnittstelle zwischen dem im Kurs Allokationstheorie Gelernten und dem in der Realität dieses Erdballs Wahrgenommenen 😱 ?
Bisher konnte ich alles aus der VWL - zumindest grob - mit Inhaltes des Wirtschaftsteiles der Zeitungen in Verbindung bringen: reale und monetäre Außenwirtschaft, Stabi-politik, Umweltökonomie, Industrieökonomik, ja sogar ÖTP...
Aber Allo?
Das two-by-two-by-two Modell kann ich auf eine Robinson-Wirtschaft anwenden. Klar, ist ein Modell, nicht Realität - ok!
Ich sehe aber keine Erkenntnisse darüber, wie man irgendwelche Ergebnisse aus diesem Modell auf eine Wirtschaft mit 100 Sektoren und 100 Millionen Konsumenten / Produzenten umlegen kann/soll.
Berechnen wir ein Produktionsoptimum und dann ein Konsumoptimum und vergleichen wir nachher, obs übereinstimmt - schön und mathematisch auch nicht sooo anspruchsvoll (gut, die Klausur wird mich da eines Besseren belehren....) - aber was bringt das?
Hat jemand eine Idee?
